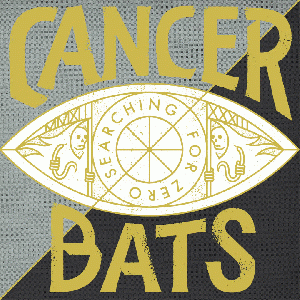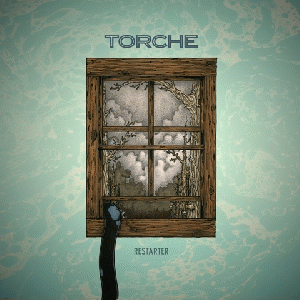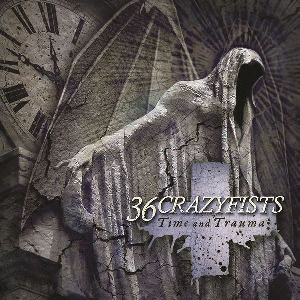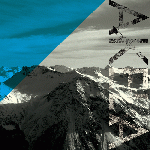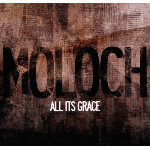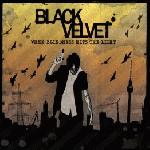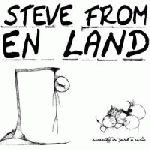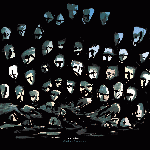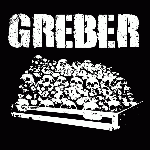
Greber - Hometown Heroin
Marc Bourgon, der hauptamtlich bei Fuck The Facts für die tiefen Töne zuständig ist, macht schon seit geraumer Zeit gemeinsame Sache mit Steve Vargas, der, wenn er sonst nichts zu tun hat, bei The Great Sabatini das Schlagzeug verhaut. Nachdem die bisherigen Kooperationsbemühungen der Beiden aber irgendwie alle im Sande verlaufen sind, ziehen die Kanadier anno 2010 etwas Neues auf: Greber. Keine Ahnung, ob die Jungs keine zusätzlichen Musiker finden konnten oder wollten, jedenfalls beschränkt man sich auf Drum & Bass plus Gesang. Wer jetzt allerdings an elektronische Beats und funkige Grooves denkt, ist komplett falsch abgebogen. Die acht Stücke (inklusive Ein- und Ausleitung) auf âHometown Heroinâ sind allesamt verdammt schwere Grind-Brocken, die extrem rau und grobkantig daherkommen und alles andere als leicht verdaulich sind. Ebenso unkonventionell wie die Instrumentierung ist auch das Songwriting, denn geradlinige Strukturen und Eingängigkeit sucht man hier vergebens. Stattdessen bekommt man es mit der ganz groben Kelle besorgt. Dreckige Riffs schwersten Kalibers türmen sich aus den Katakomben des Doom auf und stampfen alles in den Boden, nur um im nächsten Moment von wilden Blast-Attacken überrannt zu werden, mit denen auch der letzte Hauch von Tradition und Konservatismus weggefegt wird. Gesangstechnisch kotzen sich Greber so richtig aus. Ziemlich schizophren und vollkommen durchgeknallt brüllen und keifen sich die Beiden durch die Songs, dass es eine wahre Pracht ist. Gelegentlich unternimmt das Duo aber auch kleine, melodische Exkursionen in die dunkelsten Kellergewölbe des Blues und zeigt hierbei, dass sie auch über eine ruhige, nachdenkliche Seite verfügen. GröÃtenteils wird das Gaspedal auf âHometown Heroinâ aber bis zum Anschlag zugetreten. Man muss sich dabei übrigens immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass hier lediglich zwei Mann am Werk sind, denn der verzerrt dröhnende und kreischende Bass entfaltet in Kombination mit dem rohen Schlagzeugsound einen erstaunlichen Druck, der den Hörer immer wieder in den Sessel presst. Allerdings haben sich auch ein paar Passagen eingeschlichen, in denen die scharfe Kante einer sägenden Gitarre ziemlich schmerzlich vermisst wird. Deshalb wirken vor allem einige der Frickelteile im Vergleich zum Rest der Platte etwas flachbrüstig. Bis auf diese Ausnahmen ist das Debütwerk von Greber aber eine 23 Minuten andauernde Arschtreterei, die verdeutlicht, wie wirkungsvoll Minimalismus sein kann, sofern er richtig eingesetzt wird. Für Freunde kranker Grindmucke sehr zu empfehlen! (cj)